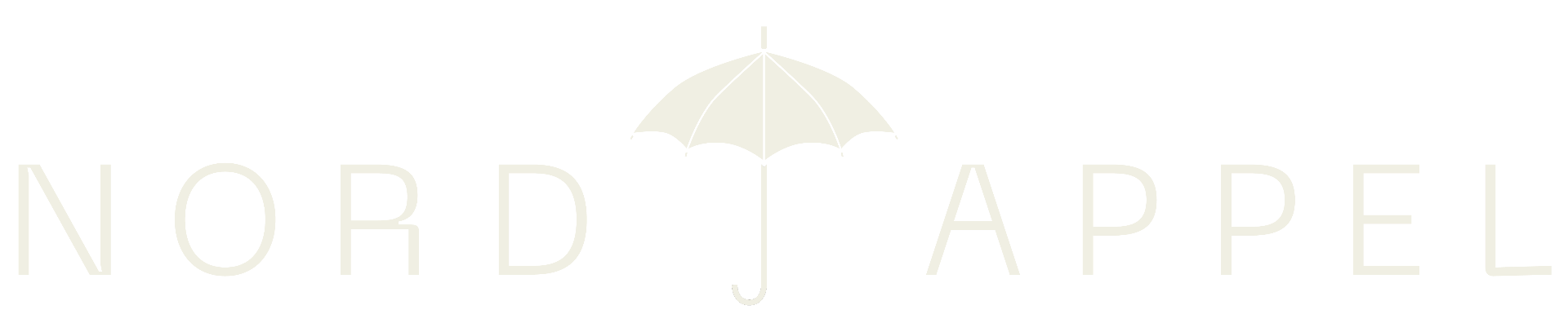Produktionsintegrierte Kompensation
Was ist PiK?
Die Wahrheit über unsere Niedersächsische Agrarlandschaft ist leider, dass Sie sich streckenweise als ökologische Wüste zeigt.
Die Eingriffsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes Verpflichtet jede Bauträgerin in Deutschland für einen durch sie verursachten Eingriff in eine Landschaft bzw. ein Biotop Ausgleich zu schaffen, der verlorenen Biotop-Wert durch eine ökologische Aufwertung andernorts kompensiert. Dies kann auf unterschiedliche Weise geschehen wird Flächenkompensation gennant. Hierbei bildet Produktionsintegrierte Kompensation einen Spezialfall, der seit über zehn Jahren Deutschlandweit erprobt wird, mittlerweile eine gängige Praxis in vielen Bundesländern geworden ist und eine wichtige Weiterentwicklung des bisherigen Naturschutzverständnisses darstellt, bei dem der Mensch aus der Natur ausgeschlossen werden sollte.
Produktionsintegrierte Kompensation (PiK) ist eine Methode ökologischer Aufwertung, bei der landwirtschaftliche Flächen so bewirtschaftet werden, dass sie nicht nur Erträge liefern, sondern gleichzeitig ökologische Funktionen erfüllen. Ursprünglich entwickelt, um den Verlust von Ökosystemleistungen auszugleichen und gleichzeitig landwirtschaftliche Flächen zu erhalten, hat sich PiK zu einem wertvollen Instrument im modernen Naturschutz entwickelt. PiK ermöglicht potentiell eine viel großflächigere ökologische Aufwertung, da sie per Definition Naturschutzflächen nicht der landwirtschaftlichen Produktion entziehen muss.
Dadurch können wichtige Funktionen wie der Biotopverbund deutlich verbessert werden und durch kleine Änderungen der Bewirtschaftung bereits große Effekte erzielt werden.
Bei den meisten Maßnahmen werden verhältnismäßig kurzlebige Elemente wie Blühstreifen, schonendere Bewirtschaftungstechniken im Ackerbau oder eingeschränkte Mahd im Grünland eingesetzt. Gerade in Niedersachsen liegt bei PiK-Maßnahmen klar der Fokus auf Ackerbau und Grünland, doch aus überregionaler Erfahrung zeigt sich immer wieder Streuobst als wertvollste Methode für eine Integration von landwirtschaftlicher Produktion in langfristigen Naturschutz. Dass diese Königsdisziplin des produktionsintegrierten Naturschutzes von unterschiedlichen Seiten skeptisch gesehen wird wollen wir in diesem Artikel anerkennen und unsere Sichtweise formulieren.
Der Wunsch nach einer harmonischen und lebenswerten Landschaft, die gleichzeitig Lebensmittel produziert sitzt tief.
Ist PiK Trumpf?
Denn Nordappel verwendet PiK zur langfristigen und rechtsicheren Anlage, Pflege und Bewirtschaftung von Streuobstwiesen und schafft auf diese Weise Mehrwehrte in ökologischer und ökonomischer Hinsicht, aber auch für Bauträger und Gemeinden, die zur Kompensation verpflichtet sind. Wir glauben, dass Streuobst als PiK-Maßnahme, sowohl naturschutzfachlich zu den effektivsten gehören und gleichzeitig ökonomisch attraktiv sein kann.
PiK-Maßnahmen werden gezielt auf aufwertungsfähige und -bedürftige Flächen angewendet. Dies sind vornehmlich intensiv bewirtschaftete Ackerflächen und Grünland. Eine Mahdumstellung oder eine veränderte Ackerbau-maßnahme müssen langfristig rechtlich gesichert und unterhalten werden, um ihre Wirksamkeit zu gewährleisten. Häufig gehen diese mit einer gewissen Ertragsminderung für die beteiligten LandwirtInnen einher, was bestenfalls durch Kompensationszahlungen ausgeglichen werden kann. Nicht viele sind bereit sich in ihrer Bewirtschaftungsform einschränken zu lassen und sich langfristig zu binden. Die Anlage einer Streuobstwiese, deren Bäume eine zeitaufwendige Anwuchspflege brauchen und die erst nach vielen Jahren Erträge produziert für die oft kein Markt angenommen wird, ist für die wenigsten Maßnahmenträger attraktiv.
Jedoch fördert die extensive Nutzung von Grünland durch reduzierte Düngung und längere Mahdintervalle die Artenvielfalt ungemein; Vögel wie der Neuntöter und der Steinkauz profitieren von solchen strukturreichen Lebensräumen. Der Neuntöter bevorzugt offene Landschaften mit Hecken und Gebüschen, während der Steinkauz halboffene Landschaften mit alten Obstbäumen bevorzugt. Diese und viele andere Pflanzen-, Insekten-, Vogel- und Kleinsäugerarten finden in extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen und Streuobstwiesen ideale Bedingungen. Sodass Naturschutzbehörden für solche Maßnahmen immer BewirtschaftungspartnerInnen suchen.
Unsere halboffene Kulturlandschaft ist schon seit tausenden Jahren durch menschliche Bewirtschaftung geformt. Davor haben Großsäuger die Landschaften vor der Bewaldung bewahrt. In und mit dieser halboffenen Landschaft hat sich unsere reiche Flora und Fauna entwickelt. Viele unserer schützenswerten Tier- und Pflanzenarten sind auf eine regelmäßige Beweidung, Mahd oder Bearbeitung des Bodens angewiesen. So können Grünlandstandorte mit einer insektenschonenenden Mahd zu den artenreichsten Biotopen gehören. Dies potenziert sich noch, wenn es sich um eine extensive Beweidung ohne zusätzliche Düngung handelt und die allerhöchsten Werte haben solche Wiesen, wenn noch ein alter Obstbaumbestand in gutem Pflegezustand darauf steht, da diese viele zusätzliche ökologische Nischen bereitstellen.
Eine Umstellung der Grünlandnutzung kann die Biodiversität schnell nach oben schnellen lassen.

Viele Streuobstwiesen, die als Kompensationsmaßnahmen ohne Nutzungskonzept angelegt wurden sehen nach kurzer Zeit so aus; wegen mangelnder Pflege gehen die Bäume schnell ein und der ökologische Wert bleibt unerreicht.
Der Steinkauz ist ein prominenter Bewohner norddeutscher Streuobstwiesen.
Trotz der vielen Vorteile gibt es Bedenken hinsichtlich des hohen Pflegeaufwands von Streuobstwiesen und der Zielkonflikte zwischen Ertragsnutzung und Naturschutz. Gerade Streuobstwiesen erfordern regelmäßige Pflege, einschließlich Baumschnitt, Mähen oder Beweidung, was einen hohen Arbeits- und Kostenaufwand bedeutet. Naturschutzbehördern haben daher berechtigte Sorgen, dass zu intensive Bewirtschaftungsmethoden zur Maximierung der Erträge die ökologischen Ziele beeinträchtigen. Zudem erfordern diese als PiK-Maßnahmen noch langfristigere Verpflichtungen und noch strengere Einschränkungen als einfachere Mahdumstellungen im Grünland. All das lässt dann auch LandbesitzerInnen und LandwirtInnen zögern, sich auf solche Programme einzulassen.
Hier werden Nutzung und Naturschutz oft als unvereinbare Gegensätze wahrgenommen und behandelt. Naturschutzbehörden fühlen sich gezwungen, die ordnungsgemäße Durchführung zu kontrollieren und Landwirte fühlen sich gegängelt und in der Ausübung Ihrer Tätigkeit eingeschränkt.
Da es dann auch noch bei Vielen wenig Wissen, um die naturschutzfachliche und nutzungsorientierte Streuobstplanung, -anlage und -pflege vorhanden ist, sind die Maßnahmen bei denen Streuobst durchgeführt wird in sehr schlechtem Zustand und erfüllen bei weitem nicht die angestrebten Ziele. Diese Erfahrung hat Streuobst als Kompensationsmaßnahme in den letzten Jahren einen schlechten Ruf verschafft. Dies halten wir zwar für nachvollziehbar, da auch wir glauben, dass genauer geprüft werden muss, wo und wie Streuobst wirklich nachhaltig durchgeführt werden kann, aber sind Überzeugt, dass Streuobst ein noch weithin ungenutztes Potential für PiK in Niedersachsen bietet.
Braunkehlchen auf Holunderstrauch
Nordappel + PiK = <3
Wir glauben, dass es sich hier nicht um einen unauflöslichen Konflikt handelt, sondern im Gegenteil dass gerade Streuobst hier wirklich eine neue Dimension von Naturschutz in Verbindung mit Urproduktion ermöglicht. Damit von hochstämmigen Obstbäumen langfristige und wirtschaftlich attraktive Erträge abgeworfen werden, müssen diese auf eine möglichst lange Lebensdauer und eine möglichst gesunde Konstitution hin ausgewählt, gepflanzt und erzogen werden. Ökologisch und naturschutzfachlich sind genau diese alten Bäume die wertvollsten. Nach der Pflanzung sich selbst überlassene Bäume werden weder alt, noch ökologisch wertvoll, geschweige denn ökonomisch einträglich. Das Untersagen einer wirtschaftlichen Nutzung der Bäume, wie es von vielen unteren Naturschutzbehörden (UNBs) nach wie vor praktiziert wird, um des Naturschutzes Willen, ist um des Naturschutzes Willen kontraproduktiv, da so jeder Anreiz genommen ist, diese Bäume so zu pflegen, dass sie alt und schützenswert werden können.
Die neu angelegten Streuobstwiesen von Nordappel haben das Potential auch für kommende Generationen Nutzungsperspektiven zu bieten.
NordAppel hat ein umfassendes Modell zur Nutzung von Streuobstwiesen entwickelt, das alle Vorteile verbindet und bietet sich so als idealer Bewirtschaftungspartner für PiK-Maßnahmen rund um Streuobst!
Zudem ist eine extensive Schnitt- oder Weidenutzung ideal in eine Obstnutzung integrierbar. Genauso wie auch Staffelmahd und überjährige Säume, sowie Hecken, die alle jeweils wichtige Schutzfunktionen für viele Arten übernehmen und längst anerkannter Teil von PiK-Maßnahmen sind.
Es zeigt sich also, dass eine auf langfristige Nutzung angelegte Streuobstwiese unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten von kaum einer anderen PiK-Maßnahme übertroffen werden kann.
Alte Bäume bieten viel Lebensraum für Vögel, Kleinsäuger und Insekten.
Unsere Streuobstbäume werden jährlich geschnitten, gepflegt und bei Bedarf nachgepflanzt, um eine kontinuierliche und nachhaltige Nutzung sicherzustellen. Die Nutzung und Veredelung der Streuobsterträge zu Most und Cider bieten uns einen starken finanziellen Anreiz, die Pflege der Streuobstwiesen langfristig zu gewährleisten. Als ökologischer Landwirtschaftsbetrieb verzichtet NordAppel selbstverständlich auf den Einsatz von Pestiziden und Kunstdüngern, was zur Förderung der Biodiversität und zur Erhaltung eines gesunden Ökosystems beiträgt.
Der Neuntöter braucht lichte Wälder und dornige Hecken zum Brüten. Streuobst mit Heckeneinfriedung kann hier ein optimales Habitat bieten.
Alter Streuobstbestand ist nur aufgrund eines Nutzerinteresses so alt geworden!
Der Ortolan profitiert von kleinstrukturierten Landschaften, Säumen, Hecken und geschützten Nistplätzen neben Ackerfruchtkulturen.
Streuobstwiesen haben von Natur aus eine potentiell lange Lebensdauer, weshalb wir ein großes Interesse daran haben, die Maßnahmen weit über die meist vorgeschriebenen 15 Jahre hinaus zu schützen und zu pflegen. Der Ertrag der Bäume erreicht erst nach vielen Jahren seinen Höhepunkt, was die langfristige Nutzung wirtschaftlich sinnvoll und ökologisch wertvoll macht. Wir legen unsere Wiesen aber auch immer als generationsübergreifendes Projekt an. Da die kosten- und zeitintensivste Pflegearbeit in den ersten 25 Jahren stattfindet und gut erzogene Bäume ab diesem Alter nur noch gelegentliche Erhaltungsschnitte benötigen, bleibt es für kommende Generationen “nur noch” zu ernten. Streuobst wurde früher zur Selbstversorgung angelegt und die unterschiedlichen Obstarten sollten möglichst lange Erntefenster bieten. Dem gegenüber wollen wir für uns und kommende Generationen nur einen Erntetermin und auf Weiterverarbeitung ausgelegte Sortenzusammensetzungen, um dadurch die Erntekosten bei idealer Reife niedrig zu halten. Auch werden dadurch werden die Zeitfenster in denen Menschen die Wiese und ihre nicht-menschlichen Bewohner stören verringert. WinWin!
Ein weiterer entscheidender Aspekt des Modells von Nordappel ist die Öffentlichkeitswirksamkeit. Durch die Produktion von Cider und Bildungsangebote wird die Bedeutung der Streuobstwiesen der Öffentlichkeit nicht nur als ästhetisches, sondern auch kulinarisches Kultur- und Naturerbe nähergebracht. Die professionelle Pflege der Bäume nach guter fachlicher Praxis kann eine Leuchtturmfunktion für andere derartige Projekte, denn sie sorgt dafür, dass die Bestände wirklich alt werden können. Dies fördert nicht nur die ökologische Wertigkeit der Streuobstwiesen, sondern auch Qualität als Elemente einer Lebenswerten Kulturlandschaft. Unsere Arbeit und Produkte zeigen Menschen, dass Naturschutz und eine handwerkliche Produktion von genussvollen und gesunden Nahrungsmitteln kein Gegensatz sein müssen, sondern Hand in Hand gehen können!
Wir von Nordappel nutzen und pflegen diese wertvollen Kulturlandschaften optimal für die Mostproduktion und schaffen dadurch gleichzeitig wertvolle Lebensräume für zahlreiche Arten.
Quellen:
Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen -
1/2023 Arbeitshilfe Produktionsintegrierte Kompensation
2/2015 Beiträge zur Eingriffsregelung VI
2/2017 Beiträge zur Eingriffregelung VII
Der Niedersächsische Weg -
Maßnahmenpaket für den Natur-,
Arten- und Gewässerschutz
Gesamtausgabe (Stand 07/2022)
Ökosystemleistungen in ländlichen Räumen --
Grundlage für menschliches Wohlergehen und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung
ÖSL_TEEB_DE_Landbericht_Langfassung.pdf